Da ich öfters gefragt wurde, wieso ich Spinner und Fast genial nach ihrer Veröffentlichung noch mal umgeschrieben habe und was sich dabei veränderte, wollte ich – wir schreiben das Jahr 2018 – einen zweiten Blick in die Werkstatt werfen. Denn nicht zuletzt habe ich bei diesem Prozess vieles über das Schreiben gelernt, was vielleicht auch für andere nützlich ist. Zugleich liegt es in der Natur der Sache, dass ein Text über das Überarbeiten von Büchern vor allem ein Text über eigene Fehler ist und Spoiler enthält.
(Der 1. Blick in die Werkstatt findet sich hier).
Einen bereits veröffentlichten Roman umzuschreiben klingt ungewöhnlich, doch in Wahrheit setzen sich viele Autor*innen noch mal an ihre Werke. Es gibt berühmte internationale Beispiele wie Lew Tolstoi, der gleich sechs Versionen von Krieg und Frieden herausgebracht hat, die sich teils erheblich voneinander untertscheiden (meine Lieblingsfigur hätte in der ersten Fassung überlebt). Mary Shelley veröffentlichte Frankenstein erstmals 1818 und schrieb den Roman nach persönlichen Schicksalsschlägen 1831 noch mal um – zu der Fassung, die wir heute kennen. Genauso hat Evelyn Waugh, vierzehn Jahre nach Erscheinen, seinen Roman Brideshead Revisited stark überarbeitet, auch George Eliot veränderte das Ende ihres Romans Middlemarch.
Aber auch deutschsprachige Schriftsteller wie Wolfgang Herrndorf oder Daniel Kehlmann haben schon mal einem früher veröffentlichten Werk nachträglich den letzten Schliff gegeben oder ihm behutsam etwas hinzugefügt.
Totzdem wird dieses Vorhaben eher misstrauisch beäugt, schließlich entwickelt ein veröffentlichter Roman im besten Fall ein Eigenleben. Überarbeitet man ihn dann in aller Öffentlichkeit, hat es immer etwas von einer Operation am offenen Herzen. Man braucht also gute Gründe für diesen Schritt – und meist hängen sie stark mit der Entstehungsgeschichte des jeweiligen Romans zusammen.
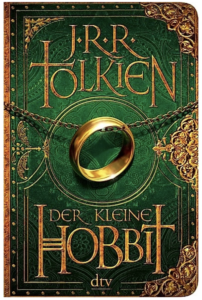
J.R.R. Tolkien musste aus ganz anderen Gründen noch mal ran: Nach der Arbeit an „Der Herr der Ringe“ änderte er mehrere Stellen im deutlich früher erschienenen „Der kleine Hobbit“, um sie an sein Hauptwerk anzupassen – in der ersten veröffentlichten Version gab Gollum den Ring noch freiwillig her …
Spinner
Teil I: Wie das Buch entstand
Spinner war nicht das erste Buch, das ich schrieb, sondern das dritte. Das erste Buch schrieb ich mit achtzehn in den Sommerferien und es ist so schlecht, pseudo-moralisch und weinerlich, dass man mich heute damit erpressen könnte.
Das zweite Buch schrieb ich in meinen ersten Wochen in Berlin, eine Dreiecksliebesgeschichte mit einem Fight Club-ähnlichen Twist (den ich zu meiner Ehrenrettung damals noch nicht gesehen hatte). Wenn man es nett formulieren möchte, war diese halbfertige Geschichte ein bisschen seltsam. Wenn man es weniger gut meint, könnte man beim Lesen auf die Idee kommen, der Autor wäre in der winterlichen Einsamkeit seiner Berliner Bruchbude verrückt geworden. Dieses zweite Buch hat nur ein einziger Mensch gelesen, er fand es sehr schlecht und damit immer noch besser als der Verfasser selbst.
Das dritte Buch war dann Spinner, das damals noch Traumjäger hieß. Ich war noch immer neunzehn und schrieb mir darin meine Zeit in Berlin von der Seele, kämpfte mich durch bizarr schlechte erste Fassungen, ließ keinen Fehler eines Schreibanfängers aus, suchte mir Leute, die mich hart kritisierten, schrieb Fassung drei, vier, fünf, steigerte mich ein wenig, las John Irving und Nick Hornby, las Michael Chabon und J. D. Salinger, versuchte ihnen nachzueifern, verfehlte meine Idole, stieß dabei zufällig auf etwas anderes, nämlich meinen eigenen Ton, schrieb Fassung sechs, sieben, acht, kam der Sache langsam näher, hatte aber keine Ahnung, was diese Sache war. Spielte auch keine Rolle, denn es hagelte weiter Absagen, so dass ich mich irgendwann entnervt in mein zweites Buch flüchtete: Über einen Musiklehrer Ende dreißig in der Midlife-Crisis. Diese Geschichte war ganz weit weg von mir. Und am Wichtigsten: Diese Gechichte hatte noch niemand abgelehnt, sie erlaubte mir, weiterzuträumen.
Spinner dagegen blieb auf scheinbar ewig in der Schublade, und ich weiß noch, wie ich Jahre später zu meiner damaligen Freundin sagte (die das Buch nicht mochte): „Vielleicht nehme ich auch einfach die besten Teile der Geschichte und mache damit was Neues, den Rest werfe ich weg … wie wenn man ein altes Auto auschlachtet und noch das Radio und die Felgen mitnimmt, bevor man es verschrottet.“
Well, it was love …
Ende 2007 kam ich zum Diogenes Verlag, der damals die Rechte an Becks letzter Sommer gekauft hatte. Bei meinem ersten Besuch in Zürich brachte ich etwas verschämt auch Spinner mit, das war ich diesem gebeutelten alten Ding irgendwie schuldig – und zu meiner Freude und Überraschung entschied der Verlag, es ebenfalls zu publizieren. Wer hätte gedacht, dass die Figuren um den Helden Jesper doch noch das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden.
An diesem Punkt hätte ich alles tun müssen, um diese Chance zu rechtfertigen und die unausgereifte Geschichte so gut wie möglich in Form zu bringen. Ich hätte wie ein Verrückter den Text überarbeiten müssen, ein; besser zwei Jahre lang. Stattdessen beschloss ich, kaum etwas zu verändern, da ich meinem neunzehnjährigen Ich nicht reinreden wollte. Das Buch sollte authentisch bleiben und fertig, entschied ich – aber da war ich noch ein anderer Autor.
Denn trotz nun zwei Veröffentlichungen wusste ich fast nichts vom Schreiben, außer den Dingen, die ich intuitiv gelernt hatte. Ich war inzwischen vierundzwanzig Jahre alt, ungeduldig, ich hielt mich für jemanden, der in kurzen Abständen ein Buch nach dem anderen schreibt. Damals kannte ich mich weder als Mensch noch als Autor besonders gut, lief aber nach dem jahrelangen Misserfolg plötzlich auf Buchmessen herum. Ich erlebte den zu großen Feuilleton-Hype um Becks letzter Sommer genauso staunend mit wie den Flop mit Spinner (den ich dringend nötig gehabt hatte und der sehr hilfreich war), ich war misstrauisch, sagte die meisten medialen Anfragen ab, ließ mich aber ein paar Mal überreden – und gab dann als sogenannter „Jungautor“ teils holzdumme Interviews.
Wer jung veröffentlicht, wird ein Stück weit in der Öffentlichkeit erwachsen. Später blickt man dann mit der gleichen Verlegenheit auf frühe Romane oder manche Aussagen, mit der andere durch alte Tagebücher blättern. Als junger Mensch fehlte mir im Grunde eine Sprache für das, was da fast über Nacht mit meinem Leben geschehen war, und heute ist mir die Person, die ich in diesen ersten Jahren nach meiner Veröffentlichung war (oder sein wollte) abwechselnd etwas peinlich oder fremd – als hätte ich in dieser Zeit eine zweite Pubertät durchgemacht.
Damals wusste ich nur, dass ich aus diesem Trubel, diesem „Betrieb“ wieder raus wollte. Mit einem Anruf beim Verlag verschob ich eigenmächtig Fast genial, dann zog ich nach Barcelona. In meinen drei Jahren dort reflektierte vieles in meinem Leben, ich studierte aber auch noch mal meine früheren Helden wie Fitzgerald und Irving, ich las Carson McCullers, Jeannette Walls und verschiedene Romane von Kazuo Ishiguro, der meine Ideen vom Schreiben stark veränderte.
Es ging nicht darum, ein perfektes Buch zu schreiben, meine Texte würden immer ihre Schwächen haben. Aber all diese Autor*innen lehrten mich Ernsthaftigkeit für meinen Beruf – und wie wichtig es ist, sich genügend Zeit zu nehmen. Damals arbeitete ich schon seit Jahren parallel an Vom Ende der Einsamkeit und begriff, dass ich dieser Geschichte noch immer nicht gewachsen war, dass ich noch viel mehr lernen musste.
Ich freute mich auf diese Herausforderung, das „Problem“ war nur: Als ich mit achtundzwanzig Jahren endlich eine präzise, erwachsene Vorstellung davon hatte, was für ein Schriftsteller ich sein wollte, hatte ich bereits drei Romane veröffentlicht.
Teil II: Die Überarbeitung
Vor allem zu Spinner hatte sich mit der Zeit eine Hassliebe entwickelt. Einerseits war ich beim Schreiben des Kerns neunzehn gewesen, und es steckte so viel ehrliche Wut, Unsicherheit und Jugendgefühl von mir in diesem Text; nie mehr würde ich das so authentisch empfunden zu Papier bringen können.
Andererseits bereute ich längst, die Geschichte so unfertig veröffentlicht zu haben, denn es gab vieles, was mir an ihr missfiel. So hatte ich den Text einfach nicht sorgfältig genug überarbeitet. Fast alle Nebenfiguren, gerade die weiblichen, waren zweidimensional und platt, zudem hatte ich mich viel zu oft hinter Ironie und Pointen versteckt. Mit neunzehn hatte ich mich nicht getraut, manche Stellen auch mal ernster und ruhiger zu schreiben und bei Figuren und Szenen stärker in die Tiefe zu gehen. Ich hatte damals Angst, das sei für die Leser*innen langweilig und mich würde dann erst recht niemand veröffentlichen. Doch als überraschend der Vater eines guten Freundes starb, schämte ich mich dafür, wie oberflächlich ich mit solchen Themen im Buch umgegangen war.
Ich fing an, auf Lesungen abzuraten, wenn sich jemand Spinner kaufen wollte; es störte mich, dass Menschen Geld für etwas ausgaben, bei dem der Autor schlichtweg seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Auf die Idee, mich tatsächlich noch mal an diese Geschichte zu setzen, kam ich jedoch erst bei der Suche nach einem Cover für Vom Ende der Einsamkeit. Ich klickte mich durch die Arbeiten der wunderbaren Künstlerin Elizabeth Peyton, und als ich ihre Schwarzweiß-Zeichnung vom jungen Marc Jacobs entdeckte, war mein erster Gedanke: „Das wäre eigentlich das ideale Cover für Spinner gewesen!“ Mein zweiter Gedanke war: „Na ja, aber das Cover wäre ehrlicherweise viel zu gut für den Roman, dann müsste ich vorher erst die Geschichte umschreiben.“
Kurze Stille in meinem Zimmer; in einem Comic wäre bei mir in diesem Moment eine Glühbirne im Kopf angegangen. Kurz darauf rief ich meinen Verleger an und fragte ihn, ob ich das wirklich machen dürfe: Nicht nur ein neues Cover für Spinner, sondern gleich auch den ganzen Roman umschreiben …
Ich durfte.
Ich ließ mir also Ende 2015 vom Verlag die Word-Datei des Textes zuschicken, las die ersten Zeilen – und dann kam dieser eigenartige Moment, in dem ich einfach etwas änderte. Als würde man in einem Museum mit einem feuchten Pinsel über ein (nicht sehr teures) Ölgemälde streichen.
Anfangs fühlte es sich verboten an, aber bald fiel es mir leicht. Insgeheim bereitete es mir sogar großes Vergnügen, denn dieser Text war damals über zehn Jahre alt, und zum ersten Mal konnte ich ein eigenes Buch so lesen, als wäre es nicht von mir. Subjektiv als schlecht empfundene Sätze oder unlustige Pointen stachen mir nun sofort ins Auge, aber auch, wo für mich die Stärken lagen. Ich wollte auf keinen Fall den rohen, teils wilden Ton verändern, denn nie wieder würde ich so jung einen Text schreiben können. Stattdessen versuchte ich, meinem neunzehnjährigen Ich eine Art älteren Lektor zur Seite stellen und mit ihm das Manuskript immer und immer wieder durchzugehen.

„Spinner“ in der 10-Year-Challenge, 2009 und 2019
Eine der Hauptbaustellen war dabei der Protagonist. So war Jespers Wut bisher oft nur behauptet gewesen, aber nicht richtig begründet. Ich gab der Geschichte um den Tod seines Vaters mehr Raum und Tiefe und versuchte diesem Thema besser gerecht zu werden. Durch viele kleinere Stellen wie den verlorenen Abschiedsbrief oder Gespräche mit der Mutter, aber auch durch die großen kursiven Rückblenden. In der alten Version erfuhr man die Hintergründe über den Tod von Jespers Vater direkt am Anfang, diesmal spielte ich das Blatt langsamer und bewusster aus. Nun erzählt Jesper zunächst allen, es sei ein Herzinfarkt gewesen. Erst am Ende gibt es einen emotionalen Moment mit seinen Freunden, als er ihnen berichtet, was wirklich geschah: Dass es ein Suizid gewesen war und er danach das Gefühl gehabt habe, sein Vater hätte ihn im Stich gelassen …
Es ging beim Überarbeiten nie darum, den Protagonisten schlauer oder reifer zu machen, im Gegenteil. Ich wollte, dass man Jesper auch in seinen Unzulänglichkeiten besser versteht. Ich habe immer versucht, den übermütigen Sound des Buchs und seiner jungen Hauptfigur so zu lassen, ihn sogar teilweise subtil auszubauen. Wenn Jesper in einer Bar eine Sängerin entdeckt, die ihn rührt und seine Einsamkeit unterstreicht, wenn er in absurden Situationen nur noch seinen linken Schuh wegwerfen will oder „I scream, you scream, we all scream for ice cream“ ruft, wenn er über seine Mitschüler und ihre Angst vor Lücken im Lebenslauf nachdenkt, wenn er nach einem missglückten Flirt sein fünfzigjähriges alleinstehendes Ich vor sich sieht, das ihm höhnisch applaudiert, dann ist das alles und vieles weitere neu.
Im Gegenzug habe ich in meinen Augen nicht witzige oder unpassende Schlenker entfernt, schwache Sätze rausgeworfen, zähe oder schwammig beschriebene Stellen gekürzt und verdichtet, hölzerne Schilderungen überarbeitet. Ich versuchte zudem, den Nebenfiguren etwas mehr Tiefe zu geben, ersetzte die überzeichnete Eva durch die hoffentlich besser passende stillere Hannah, und verstärkte die Freundschaftsmomente mit Gustav und Frank. Teilweise waren es auch hier größere Änderungen wie komplett neue Szenen, teilweise nur Details, wie die Spitznamen, die Gustav nun an seine Freunde vergibt oder dass er Jesper in ihrem Streit – verbal – deutlicher ausknockt. Und mal salopp gefragt: Ist es wirklich gut, wenn der frisch geschiedene und stets mürrische Haller am Telefon auch noch jemanden fertigmacht oder wäre es nicht unerwarteter und ein schöner Kontrast für diesen Charakter, wenn er da plötzlich liebevoll spräche, nämlich mit seiner kleinen Tochter?
Wenn es hart auf hart kam, wenn ich an eine Stelle geriet, die mir nicht mehr gefiel, die ich aber mit neunzehn geliebt habe – dann habe ich sie gelassen. Spinner ist auch jetzt nicht für jede*n, der Roman ist bewusst nicht rund, ruckelt manchmal und hat nach wie vor seine story-technischen Flapsigkeiten (den Nebenplot mit den beiden Romanfiguren, die Jesper verfolgen, würde ich heute nicht mehr machen). Man soll auch weiterhin spüren, dass dieser Text von einem Teenager geschrieben wurde. Hätte ich nur eine Sekunde lang das Gefühl gehabt, ich könne mich mit Anfang dreißig nicht mehr in die Sprache oder Denke von Jesper hineinversetzen oder würde meiner Hauptfigur etwas Fremdes, unpassend Älteres überstülpen, hätte ich das Projekt abgebrochen. Aber das war nie der Fall, und zu meiner Erleichterung konnte auch später fast niemand die neuen Szenen von den bisherigen unterscheiden – nahezu alle altklugen, nervigen Gedanken von Jesper waren schon vorher drin (mehr über die Hintergründe des Romans und auch Outtakes gibt es übrigens hier).
Und so hoffe ich, dass das Buch sich nun in jeder Hinsicht besser anfühlt als die alte Version. Für mich persönlich machte es einen riesigen Sprung, es entstand beim Überarbeiten sogar ein echtes Glücksgefühl und langersehntes Friedenschließen mit dieser Geschichte und den Figuren. Von meinen Testleser*innen, die explizit die Urfassung mögen mussten, kamen nur zustimmende Kommentare zu den Änderungen, und auch nach der Veröffentlichung war das Feedback zur neuen Ausgabe von Spinner erheblich positiver als das zur alten Version.
Die Frage war also: Wenn das Überarbeiten bei Spinner so glattging, wenn ich dort bereits nach einem halben Jahr mit der Arbeit durch war und mich nie mehr nach dieser Geschichte umdrehen musste – wieso war es beim zweiten Buch so schwierig?

An diesem Ort in Südfrankreich arbeitete F. Scott Fitzgerald an seinem Meisterwerk „Zärtlich ist die Nacht“. Nachdem die Kritik den Roman nicht mochte, erschien posthum eine überarbeitete Neufassung nach Fitzgeralds Anweisungen. Diese Neuausgabe fand allerdings noch weniger Anklang (Hemingway meinte, es wäre, als habe man einem Schmetterling die Flügel gestutzt), und so lesen wir heute die – wunderschöne – alte Version.
Fast genial
Teil I: Wie das Buch entstand
Auf die Story von Fast genial stieß ich eher zufällig im Jahr 2006. Ich hatte damals verschiedene Nebenjobs, die mir das Schreiben finanzieren sollten, meist irgendetwas zwischen Kellner, Kinomitarbeiter oder Nachtportier. Zu meiner eigenen Verblüffung arbeitete ich mit zweiundzwanzig jedoch bei einer politisch-gesellschaftlichen Fernsehsendung in der ARD. Ich fing als studentische Aushilfskraft auf zehn-Euro-Basis an, wobei mein Vorteil war, dass ich immer Zeit hatte, weil ich ja nie zur Uni ging (ich studierte laut Immatrikulationsschein u.a. Mathematik und Turkologie). In einem mir nie ganz nachvollziehbaren Prozess – der aber auf jeden Fall mit meinen Fähigkeiten am Kickertisch in der Redaktion zu tun hatte –, war ich irgendwann allein für die sogenannten „Mazen“ zuständig; die Einspielfilme, über die dann im Folgenden mit den Gästen diskutiert wurde. Mal sollte ich in einer Minute die Geschichte der Emanzipation zusammenfassen, mal alte Bundestags-Reden von Helmut Schmidt auftreiben. Das Sichten der Videos und Schreiben der Texte machte mir Spaß, genauso wie die oft brüllend komischen Redaktionssitzungen mit den Kolleg*innen, doch das alles beeinflusste meine Arbeit an den Romanen kaum.
Bis mir mein damaliger Chef einen SPIEGEL-Artikel in die Hand drückte: „Hier, vielleicht können wir daraus einen Beitrag für die Sendung über Prä-Implantationsdiagnostik machen.“
Der Artikel hieß „Genies aus der Kälte“ und handelte von einem Projekt, das es in den Achtziger Jahren in Amerika gegeben hatte; der sogenannten Samenbank der Genies. Eine wirklich bizarre Story, von der ich noch nie gehört hatte. Und: ein faszinierender Stoff. Ich suchte eine Weile nach passendem Archivmaterial, aber dann kam schon die Ansage, dass wir den Beitrag doch nicht brauchen würden.
Den Artikel warf ich erst auf den üblichen Stapel Papiermüll im Büro, nahm ich ihn dann aber instinktiv mit nach Hause und steckte ihn in eine Schublade – wo er zunächst blieb. Es war Juni 2006, ich schrieb und kürzte gerade an der 1500-Seiten-Monumental-Fassung von Becks letztes Jahr, die Fußball-Weltmeisterschaft begann, ich hatte anderes im Kopf.
Doch die Geschichte ließ mich nicht los, und im Frühjahr 2007 sah ich plötzlich einen Weg, sie zu erzählen: Ich stellte mir einen wütenden Jugendlichen aus New Jersey vor, der Francis hieß und von allen für einen Verlierer gehalten wurde. Er lebt in einem schäbigen Trailer, schreibt in der Schule nur miese Noten, seine Mutter ist bipolar und mal wieder in der Psychiatrie gelandet, und wer sein Dad ist, weiß er nicht; vermutlich irgendein Versager oder Trinker. Doch dann findet er heraus, dass sein Vater in Wahrheit ein genialer Wissenschaftler ist, und er selbst ein Produkt der Samenbank der Genies. Gemeinsam mit zwei Freunden macht sich Francis auf die Suche nach seinem Vater, eine Reise quer durch die USA mit verblüffendem Ausgang …
Kaum sah ich das alles vor mir, machte ich mich an die Arbeit. Die ersten Kapitel im Trailerpark und in der Psychiatrie der Mutter flogen mir noch fast mühelos zu. In dieser Rohfassung erzählte Francis alles selbst aus der Ich-Perspektive und hatte eine große Klappe, mit der er alles und jeden auseinandernahm: seine Nachbarn und Mitschüler, seinen besten Freund Grover, aber vor allem sich selbst. Mehrere Tage lang schrieb ich mich in einen Rausch, bis mir dämmerte: Die Geschichte spielte in Amerika, ich war aber noch nie dort gewesen, was spätestens bei der Reise ein Problem wäre. Und ich hatte auch noch keinen Verlag. Außerdem musste ich erst mal mein zweites Buch fertigkürzen.
Ich ließ diese ersten Kapitel also erst mal so stehen, doch kaum, dass Becks letzter Sommer im August 2008 veröffentlicht war, fuhr ich mit dem Vorschuss und meinen besten Freunden nach Amerika. Da ich Flugangst habe, überquerte ich den Ozean per Schiff, danach fuhren wir knapp drei Monate mit einem Mietwagen durchs Land, zehntausend Meilen, von der Ostküste bis nach Kalifornien und Tijuana – und zurück. Unterwegs dachte ich immer wieder über die Geschichte nach, die in groben Teilen schon stand, nur das Ende fehlte mir noch. Ich wollte etwas Fieses, Prägnantes, bestenfalls Unvergessliches. Und als ich in Las Vegas gedankenverloren im Bad stand, dämmerte es mir plötzlich, und ich kritzelte mehrere Tagebuchseiten voll.
O! Mein! Gott!
Jetzt hatte ich endlich alles, um Fast genial fertigschreiben zu können (mehr über den Schluss und auch ein alternatives Ende findet sich hier).
Nach meiner Rückkehr Ende 2008 machte ich mich euphorisch an die Arbeit, doch die ersten Probleme kamen schnell. So ging mir gerade beim Schildern der Reise erzählerisch immer wieder die Luft aus. Ich dachte damals, ich müsste unbedingt eine spektakuläre Roadmovie-Szene an die nächste reihen, aber wenn ich ehrlich war, fiel mir oft nichts Neues ein.
Das andere große Problem: der Ton. Die frühen Klinik- und Trailerpark-Kapitel mit dem zynischen Francis waren mit Abstand das Lustigste, was ich je geschrieben hatte. Ich hatte immer gedacht, der restliche Roman würde genauso werden; eine Art böse Satire, vielleicht im Stil von Jesus von Texas von DBC Pierre – ein Buch, das mich damals beeindruckt hatte. Nun merkte ich, dass es nicht funktionierte. Denn je weiter die Geschichte voranschritt, desto weniger passte der bissige, zynische Tonfall noch zu den emotionalen Ereignissen unterwegs und dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Und schon gar nicht passte er zum Schluss.
Letztlich hatte ich zwei Hälften, die erzählerisch völlig schief zusammengenagelt waren: Die lustigere erste Hälfte und die dramatischere, fast verzweifelte zweite.
Ich änderte daraufhin die Perspektive in die distanziertere dritte Person, änderte auch Francis selbst und schmiss notgedrungen die meisten lustigen Stellen vom Anfang raus. Durch all das gab ich dem Buch einen deutlich kohärenteren, ernsteren und erwachseneren Anstrich. Vielleicht: zu ernst und erwachsen. Denn auch wenn da drei eher desolate Jugendliche durch die Staaten fahren, ein bisschen Spaß darf es schon machen. Und man darf eben auch fühlen, dass sie noch drei Teenager sind.
So weit dachte ich damals aber nicht.
Stattdessen hatte ich ständig Angst, dass mir jemand den Stoff mit der Samenbank der Genies noch vor der Nase wegschnappen könnte. Und vor allem war ich damals – wie oben geschildert – weniger gründlich. Ich konzentrierte mich nur auf die Story, aber viele Stellen waren nicht gut genug ausgearbeitet, immer wieder fehlte den Charakteren die Tiefe und manchen Sätzen die Raffinesse; bewusst schlichter Erzählton hin oder her.
Die Lösung liegt in solchen Fällen oft in der Zeit, die man sich dann nimmt, und dass man auch mal Abstand zu einem Text gewinnt. Damals führte ich nach dem Flop mit Spinner jedoch eine wackelige Existenz in Barcelona. Ich kellnerte irgendwann wieder und machte Schulden, um das Buch beenden zu können, hatte aber keine Krankenversicherung mehr – und parallel mit Vom Ende der Einsamkeit ein Projekt, das noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde und bei dem ich nicht wusste, wie ich es finanzieren sollte.
Unter diesem Druck feilte ich wie besessen an Fast genial, das mir hoffentlich Glück bringen würde. Ich klebte im Abgabestress so nah am Text, dass ich irgendwann das große Ganze nicht mehr sah und mir deshalb einreden konnte, das Buch sei fertig.
Erleichtert gab ich es ab – und die Urversion erschien im Herbst 2011.

Normalerweise hätte ich die Geschichte zu „Fast genial“ nicht schreiben können, da ich immer einen persönlichen Bezug brauche und mir mein eigener Vater sehr nahe war. Erst, als sich die fremde Story des Artikels mit Erlebnissen aus meinem Leben verband, bekam ich Zugriff auf das Buch. Wie genau es dazu kam, wird in „Die Geschichten in uns“ erzählt. Dort geht es auch um allgemeine Fragen zum Thema Schreiben; wie ein Roman entsteht und wieso erste Fassungen so schwierig sind, wie man verdichtet und kürzt, Spannung erzeugt oder Figuren lebendig werden lässt.
Teil II: Die gescheiterte erste Überarbeitung
Dass ich mit der zu frühen Veröffentlichung von Fast genial einen Fehler gemacht hatte, begriff ich bei den ersten Lesungen. Zwar hatte mich der unerwartete Erfolg des Romans finanziell fürs Erste gerettet, und auch das Gerüst der Geschichte schien trotz der schwierigen Entstehung zu tragen. Dennoch gab es einiges an der Geschichte, das unausgereift wirkte und mich störte – und das mir nun beim Vorlesen vor Publikum besonders stark auffiel.
So befremdete mich inzwischen Francis‘ teils gnadenlose Sicht auf andere. In der Ich-Perspektive der frühen Fassungen hatte er noch vor allem sich selbst aufs Korn genommen, das tat er jetzt kaum noch. Auch sprachlich kamen viele Stellen arg „holzhammermäßig“ und unpräzise daher, dazu hatte ich erstaunlich oft das mir sonst fremde Plusquamperfekt verwendet, um die eher dramatischen Ereignisse im Buch etwas karger und nüchterner zu schildern – passend zur inzwischen ebenfalls eher verschlossenen, distanzierten Hauptfigur. Doch es gibt einen Unterschied, ob man über die Wirkung eines einfachen Satzes bewusst nachgedacht hat oder eben nicht.
Die größte Schwachstelle von Fast genial war aber die falsche Auswahl der Szenen, weshalb ich zu selten in die Tiefe kam. Nehmen wir Francis und seine Mutter: Man hätte aufgrund ihrer bipolaren Krankheit so leicht berührende, schmerzhafte, dramatische Momente zwischen beiden schreiben können und müssen. Etwa, wenn er zu Hause merkt, dass sie wieder in den Wahnsinn abdriftet, und sie verzweifelt davor bewahren möchte. Wenn er sie später in die Klinik bringt und es auf dem Weg eskaliert. Oder wenn Francis in der Cafeteria der Psychiatrie mit Anne-May flirtet, bis er sieht, wie seine Mutter reinkommt und wirres Zeugs redet – und er sich schämt und kleinlaut wird … Es hätte unendlich viele Möglichkeiten gegeben, den Charakteren und der Krankheit der Mutter gerecht zu werden. Die Szenen, die ich stattdessen auswählte, blieben fast nur auf der Oberfläche.
Das Gleiche beim Road Trip durch Amerika: statt auf stille, besondere Szenen zu setzen, die die Charaktere der drei Jugendlichen vertiefen, reihte ich eine laute, plakative Stelle an die nächste, nur war vieles davon wenig originell (siehe ein schon tausendmal gesehener Besuch im Stripclub … Come on, eigene Fantasie, das muss besser gehen!) Auch unterwegs erzählte ich vieles eher herunter, statt hineinzuzoomen, eigentlich hatte ich als Autor bloß im Casino meinen Spaß. Das Ergebnis: Das las sich alles hoffentlich flüssig, aber obwohl im Roman teils heftige Ereignisse passierten, berührte die Geschichte lange nicht so, wie sie es könnte und sollte – vom Schluss abgesehen.
Durch die jahrelange Arbeit am Drehbuch von Fast genial hatte ich zudem viele schöne kleine Stellen und Dialoge im Kopf, bei denen ich mir insgeheim dachte: Schade, dass sie nicht im Buch sind.
Und so setzte ich mich 2016 auch noch mal an diesen Text.
Neben dem Wunsch, Francis nun besser auszutarieren und auf dem Road Trip mehr Jugendgefühl und Spaß hineinzubringen, hatte ich mir zwei Dinge vorgenommen: Ich wollte die Geschichte deutlich szenischer und subtiler erzählen. Und ich wollte Grover – im Buch dürr, linkisch und in sich gekehrt –, durch den Grover ersetzen, den ich damals für das Drehbuch schrieb; ein kräftigerer, lauter, fröhlicher, aber auch unsicherer Typ, vielleicht ein bisschen wie eine der frühen Rollen von Jonah Hill. Im Drehbuch funktionierte er wunderbar, waren er und Francis ein Team, das sich auf dem Weg durch die USA immer wieder neckte, überhaupt war ihre Freundschaft hier tiefer – wieso also nicht auch im Roman?
Das Resultat nach einigen Monaten: Die Fassung mit dem szenischeren Erzählen und dem neuen Grover war ein Desaster. Ich spürte es sofort, fast physisch, aber erklären konnte ich es mir erst nach einiger Zeit.
Das Problem am szenischeren, subtileren Erzählen: Ich hatte den Roman – angelehnt an Francis‘ Musikgeschmack und seine Leidenschaft für Eminem – immer als eine Art leicht übertriebenen Rapsong konzipiert (eine schwierige Metapher, ich weiß). Die Reise des Trailerparkjungen durch Amerika hatte oft etwas Märchenhaftes, auch wenn sie teils auf wahren Begebenheiten basiert. Und obwohl ich bei der Urfassung vieles intuitiv gemacht und keine große Ahnung vom Schreiben gehabt hatte, waren es gerade die seltsame Erzählform und der ab und zu geschwungene sprachliche Holzhammer, die die Geschichte am Ende vielleicht sogar retteten und trugen.
Im Drehbuch etwa gibt es eine Szene, in der Francis Besuch von einem der Liebhaber seiner Mutter bekommt. Das Setting ist sein Trailer. Es ist nachts, in der Küche ist es stockdunkel; sie konnten die Stromrechnung mal wieder nicht zahlen. Er ist siebzehn und allein, seine Mutter gerade in der Psychiatrie. Da klopft es an der Tür. Francis ist in dieser Szene geladen und verletzt, denn er wurde kurz zuvor von seinem Stiefvater abserviert – und nun steht ein betrunkener Mann aus dem Trailerpark vor der Tür und verlangt aggressiv nach der Mutter, die er sehen will. Francis – bis hierhin trotz seiner Wut den ganzen Film über zurückhaltend und beherrscht – nimmt nun auch die ätzenden und höhnischen Worte dieses besoffenen Typen über seine Mom nur tatenlos hin, macht am Ende die Tür zu. Eine Weile steht er nun allein in der dunklen Küche, aufgewühlt, zitternd. Beat. Plötzlich öffnet er die Tür, rennt dem Mann nach und schlägt ihn zusammen, all sein Frust entlädt sich. Denn dieser Typ ist alles, wovor er Angst hat – und nicht zuletzt befürchtet er, genau so jemand könne sein leiblicher Vater sein.
Diese Szene war für mich eine der stärksten im ersten Akt des Drehbuchs, sie beschreibt Francis nicht nur, sie zeigt ihn, also versuchte ich sie umgehend in den Roman einzubauen – doch dort fühlte sie sich einfach nur falsch an, sie passte überhaupt nicht zur Geschichte und der bisherigen Erzählstimme.
Ähnlich verhielt es sich mit den neuen dramatischen Szenen mit der Mutter, die ich mit präziserer Sprache geschrieben hatte, oder den ausgelasseneren Momenten mit Grover. Es las sich einfach nicht mehr gut, Tempo und Ton des Romans waren ein krudes Durcheinander: Hier subtil und dramatisch, dort fast unpassend fröhlich und salopp oder plakativ. Als hätte ich einen straffen, magischen Knoten zerschlagen, fiel die Geschichte mit den neuen, teils besseren Szenen erzählerisch auseinander.
Ich war verblüfft.
Bei der Überarbeitung von Spinner war es mir noch mühelos gelungen, in die alte Geschichte einzudringen, sie war eher lose konstruiert und dadurch auf eine gewisse Weise noch immer „offen“. Als hinge um den Roman nur ein simples Fahrradschloss, das leicht aufzuknacken war. Bei Fast genial dagegen war der Autor bereits einige Jahre älter und erfahrener gewesen, was Handwerk und Technik anging. Er hatte sein Buch im Kern komplexer aufgebaut und dadurch besser geschützt, den Schwachstellen zum Trotz.
Denn obwohl ich mir bei der Urversion von 2011 keine grundsätzlichen Gedanken über das Schreiben gemacht und oft auf das Plusquamperfekt zurückgegriffen hatte: Es trug mich entgegen jeder Wahrscheinlichkeit sicher durch den Anfang und passte perfekt zum ruhigen Ton des Erzählens am Lagerfeuer, den ich damals für die Geschichte im Sinn gehabt hatte. Eher beiläufig trottete man mit Francis durch seinen tristen Alltag, wurde immer wieder ironisch auf Distanz gehalten und rauschte im besten Fall nur so durchs Buch – bis mit dem Brief der Mutter plötzlich die Handlung in den zweiten Akt kippte und Francis einem näher rückte. Das „schlechtere“ Erzählen erwies sich hier als das überlegene, war es doch zumindest in sich stimmig.
Beim neuen Drehbuch-Grover wiederum war es so, dass der Roman ihn schlicht nicht annahm, ja, ihn sogar verweigerte. Er passte in beinahe keine einzige der Szenen, die jedoch so miteinander verzahnt waren, dass ich sie nicht mehr ändern konnte. Vor allem aber passte er auch nicht zum teils düsteren Ton der Ereignisse auf der Reise und der bisherigen Chemie meiner drei Figuren. Würde der fröhlichere Grover, der sich besser mit Francis versteht, wirklich das am Grand Canyon tun, was er bisher tat? Würde er das tun, was er am Ende tut? Würde das Buch dann überhaupt noch so ausgehen?
Als ich die Geschichte das erste Mal schrieb, ließ ich mich von der Gruppendynamik mitreißen. Diese drei jugendlichen Figuren verhielten sich oft nicht so, wie es vielleicht richtig und sympathisch gewesen wäre, sondern ständig so, wie sie sich nun mal verhalten wollten, und sie waren alle drei beim besten Willen keine perfekten Menschen. Drastischer formuliert: die Geschichte war mir aufgrund dieser Charaktere schon früh entglitten, und die dadurch entstandene negative Stimmung des Romans irritiert mich heute ehrlich gesagt selbst. Aber zugleich machten diese unterwegs so entfesselten, oft destruktiven Figuren für mich das Buch auch aus. Denn so entstanden ein eigentümlicher Drive und – trotz dem einen oder anderen Roadmovie-Klischee – gegen Ende eine gewisse Unberechenbarkeit. Für den Autor und hoffentlich auch für einige Leser*innen.
Anders als bei thematisch ähnlichen Filmen und Büchern lernen Francis und Anne-May manche Dinge nie, gibt es am Schluss nicht immer eine versöhnliche Rundung. So wie auch im echten Leben nicht jeder Alkoholiker oder jede Drogensüchtige die Kurve kriegen und ihr Leben ändern. In Fast genial gibt es kein Recht auf Entwicklung. Das kann enttäuschen und entnerven, aber die Figuren im Idealfall auch etwas unvorhersehbarer erscheinen lassen.
Zugleich wurde mir bei dieser gescheiterten Überarbeitung klar, wieso Fast genial für mich immer etwas schwer zu greifen war: Es ist bis heute die einzige Geschichte, die nicht aus mir selbst heraus entstanden ist, sondern auf einem Artikel basierte, dem ich mich quasi von außen annähern musste. Trotz einigen sehr persönlichen Stellen fühlte sie sich deshalb oft fremd an. Als wäre ich beim Schreiben des Romans und der Figuren hinter einer Glasscheibe gestanden, die ich nicht zerbrechen konnte.
Wie aber damit umgehen?
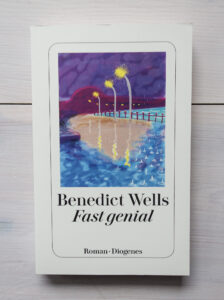
Unverändert schön: Das Cover von David Hockney.
Teil III: Die zweite, finale Überarbeitung
Da ich das Buch nicht komplett neu schreiben, sondern „nur“ überarbeiten wollte, änderte ich die Struktur zurück: weniger szenisch, dafür wieder mehr Runtererzählen wie am Lagerfeuer. Schwersten Herzens strich ich dafür die nicht zum Ton der Geschichte passenden, emotionaleren Szenen mit der Mutter wieder raus. Zudem holte ich den alten Grover zurück, an den ich jedoch näher heranzoomte. Ich gab ihm viele kleine schöne neue Stellen, so durfte er nun zum Beispiel – auf der Feuertreppe am Ende – die schlauesten Worte zu Francis sagen, die dieser auf der ganzen Reise zu hören kriegt, und die in der Urfassung gar nicht im Buch gewesen waren.
Beim ersten Überarbeitungsversuch hatte ich zu viel gewollt. Wie bei Spinner beschloss ich nun, meinem jüngeren Ich nicht mehr reinzureden. Ließ bewusst manche Stellen und Szenen drin, weil sie mir damals wichtig gewesen waren, obwohl ich sie heute nicht mehr so machen würde. Zugleich versuchte ich, auf den Schienen der Urfassung mehr Substanz hineinzubringen, mehr Wärme, Witz und jugendliches Flair. Manches ließ sich auch präziser oder origineller schreiben (eine Figur kann wie zuvor die Tür zu einer Kanzlei öffnen und dort wegen der Klimaanlage frieren oder sie kann die Tür zur Kanzlei öffnen und Sibirien betreten), anderes konnte man vertiefen:
In der Szene mit der toten Katze etwa wollte ich bewusst von außen auf Francis‘ Schmerz draufblicken, aber musste es derart kühl sein? Wenn er, Anne-May und Grover unteregs im Whirlpool sitzen, kann man da nicht noch einen schöneren Dialog bringen, können sie danach nicht noch zu dritt nebeneinander auf dem Balkon hocken? Und könnte man nicht noch eine Szene schildern, die zeigt, wie Francis schon als Kind diese fast manische, besessene Art hatte, an einer fixen Idee festzuhalten, die ihm dann später vielleicht – oder vielleicht auch nicht – zum Verhängnis wird?
Es waren gefühlt tausende kleine Änderungen, von manchen komplett neuen Szenen mit Francis abgesehen, die nun aber hoffentlich zum bisherigen Ton passten. Auch diese neue Version gab ich mehreren kritischen Testleser*innen, und wäre das Feedback nicht eindeutig positiv ausgefallen im Vergleich zur veröffentlichten Ur-Fassung, hätte ich es zurückgehalten.
So aber erschien der überarbeitete Roman Fast genial im Herbst 2018 (man erkennt ihn daran, dass es im ersten Satz nicht mehr heißt „Ich werde fliehen“, sondern „Ich werde abhauen“).
Ich muss jedoch ganz klar sagen: ich kann niemandem den Kauf des Buchs empfehlen, der es schon gelesen hat, denn das Gerüst ist ja trotzdem das Gleiche – und dafür gibt es zu viele gute ungelesene Bücher da draußen.
In einer perfekten Welt hätte ich Fast genial wohl so geschrieben, dass dramatischere und tiefere Szenen mit der Mutter genauso dazu gepasst hätten wie stubtilere, stillere Momente auf der Reise durch die USA. Die Charaktere wären vermutlich weniger toxisch und dafür austarierter gewesen, mir näher und lieber. Vielleicht hätte ich aus erzählerischen Gründen (und mit Wehmut) auf Grover ganz verzichtet, sondern mich nur auf Francis und Anne-May konzentriert. Womöglich wäre sie erst siebzehn und er erst fünfzehn gewesen; ein frühreifer Außenseiter mit gefälschtem Führerschein, was den gemeinsemen Road Trip im nun geklauten Auto ihrer Eltern noch spezieller gemacht hätte. Vielleicht hätte ich für unterwegs auch originellere, berührendere Situationen gefunden als die bisherigen, wäre vor allem auch die Sprache reifer, poetischer und feiner gewesen und hätte ein Gefühl vermittelt, das der jetzige Roman leider immer noch nicht zu transportieren vermag.
Vielleicht, vielleicht …
Denn andererseits gehörten die bisherigen Figuren und der teils saloppe, teils pessimistische Ton nun mal zu dieser Geschichte und dem Schluss. Zudem habe ich mich auch wegen meiner Fehler bei Fast genial entwickelt. Haben erst diese mir den Weg zu Vom Ende der Einsamkeit und Hard Land gewiesen, die sonst beide eventuell nie so entstanden wären.
Und vielleicht macht der Roman ja trotzdem ein paar Menschen Spaß. Ich habe mich in diesem Werkstatt-Einblick sehr auf die Schwächen konzentriert, aber meine Hoffnung ist, dass die Geschichte sich dennoch flüssig liest, manchmal auch spannend ist und an gewissen Stellen eine gewisse Wucht entfaltet. Bis hin zum fiesen Ende – diesen letzten achtzig Seiten, die einst in Las Vegas im Bad geboren wurden und die ich dann irgendwann im Frühjahr 2009 wie ein Verrückter an anderthalb Tagen runtergetippt habe (natürlich ließ ich diese Stellen beim Überarbeiten immer unangetastet).
Wer also schon seit längerem neugierig um das Buch herumgestrichen ist, dem kann ich versprechen, dass ich mein Bestes gegeben habe, um es zumindest so gut zu machen, wie es mir mit den alten Figuren, dem bisherigen Gerüst und dem dazugehörigen Erzählton möglich war.
Epilog: Und wann ist ein Buch nun fertig?
Als ich die Überarbeitungen ankündigte, schlug mir oft Skepsis entgegen: „Wieso machst du das?“ Oder auch: „Warum quälst du dich mit dem alten Zeug?“ Dieser Text ist eine Antwort. Er muss nicht für alle die richtige sein, aber er ist meine. In diesen frühen Büchern steckt sehr viel Persönliches, sie bedeuten mir noch immer viel. Ich wollte sie nicht abschenken, sondern sagen können: egal, wie jemand sie in Zukunft findet, ich habe zumindest alles für diese Geschichten getan.
(Davon abgesehen gibt es die ersten Versionen ja weiterhin im Antiquariat, auf Plattformen wie eBay und kostenlos in manchen Leih-Bibliotheken.)
Eine Veröffentlichung mag für die Außenwelt der Moment sein, in dem der Schreibprozess abgeschlossen wurde. Aber ist sie auch der Moment, in dem die Geschichte für einen selbst fertig ist? Hier hilft einem nur eine Art innerer Kompass, wann das Buch langsam „zu“ macht; ab wann es kaum noch neue Sätze, Emotionen oder Szenen annimmt und man an jeder Ecke schon mehrmals war.
Weshalb die wahre Frage ist: Wurden die Bücher nun nachträglich umgeschrieben – oder wurden sie nur endlich fertglektoriert.
Bei Vom Ende der Einsamkeit hatte ich zum ersten Mal erlebt, wie es ist, von innen an das natürliche Ende eines Schreibprozesses zu stoßen. Wie es ist, trotz Kritik von außen nichts mehr verändern zu wollen, weil man alles so erzählt hat, wie man es wollte, und über jeden Satz nachdachte. Diese Erfahrung hat meinen Blick auf das Schreiben verändert. Ich begriff: Das Endspiel beim Schreiben ist eine einsame Angelegenheit. Nur man selbst spürt, ob eine Geschichte trotz nahender Deadline für das nächste Verlagsprogramm noch Zeit braucht – oder ob sie wirklich abgeschlossen ist.
Diese Entscheidung verantwortet man immer allein. Man kann wie hier beschrieben einen Roman unter finanziellem Druck und Abgabestress zu früh veröffentlichen und Jahre später zähneknirschend überarbeiten. Oder man kann diesen Roman noch Jahre für sich behalten und die exakt gleichen Änderungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, bevor man ihn abgibt (nur ist man eben nicht immer in der glücklichen Lage dazu). In beiden Fällen spielt der Zeitpunkt des offiziellen Erscheinens bloß nach außen eine Rolle. Er ist die sichtbare Ziellinie des Verlags und der Leser*innen, aber nicht unbedingt die eigene, denn die ist unsichtbar.
Die ist ein Gefühl, mehr nicht.
–

Bei der Rückkehr zu den alten Stoffen wurde mir klar, dass jedes Buch den Zeitgeist seines jeweiligen Entstehens wie ein Wasserzeichen in sich trägt. Gott sei Dank sind wir heute vielen Themen gegenüber sensibler und bedachter als noch in den Nullerjahren. So erhielt etwa „Becks letzter Sommer“ nicht nur ein neues Cover, ich schmiss auch ein paar bescheuerte, unbedachte Stellen raus, die mich heute selbst stören (ansonsten blieb der Roman fast unverändert). Jahrelang hatte ich überlegt, eine Fortsetzung zu schreiben, die sich vor allem um Rauli dreht, meine liebste Figur aus den frühen Büchern. Als Roman sehe ich das inzwischen eher nicht mehr, aber vielleicht wird es eine Novelle. Mal schauen.